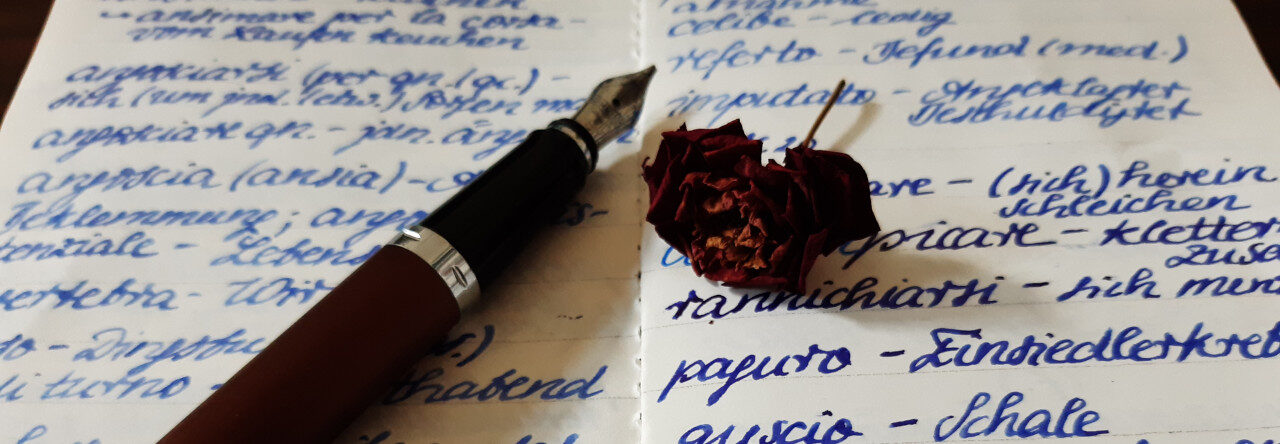Es war irgendwann im Sommer: Mein Vater hat einen Frosch auf der Hand. Jeden Tag sind wir draußen im Schrebergarten, unserem Wohnzimmer im Freien, ein paar abgezäunte Quadratmeter, auf denen die Natur uns gehört und wir ihr. Rundherum andere Kleinstaaten: Links der stets griesgrämige Nachbar, der sich über den Rasenmäher zur falschen Uhrzeit beschwert, rechts das gutmütige alte Ehepaar, das mit uns den selbstgebackenen Kuchen teilt, hinter uns ein unbekanntes Territorium, vor dem uns Hecken und Rabatten schützen. Vor uns ein riesiges Feld, weitläufiges Nichts, das im Winter brach liegt, und im Sommer von Raps, Weizen oder Mais bevölkert wird und unser Städtchen an den Horizont verbannt.
Mein Vater hat einen Frosch auf der Hand. Er hat ihn im Gebüsch gefunden, hinter der Laube, dort, wo unser Garten an das unbekannte Territorium grenzt. Er ist klein, ungefähr fingerkuppengroß, seine Haut runzlig und ebenmäßig braun, die Kehle wippt in einem fort auf und ab wie ein Herzschlag, der der Welt gehört. Ich habe noch nie so nah einen Frosch gesehen. Reglos sitzt er auf der Hand meines Vaters, als wäre dies der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Er ist wunderschön und ich möchte ihn nicht gehen lassen – er ist unser Frosch. Mein Vater baut ihm eine Hütte aus vier Holzwänden, deckt sie mit einer Plexiglasplatte ab, in die wir Löcher bohren, damit Yoshi atmen kann. Auf die Ecken lege ich jeweils einen Stein, damit Yoshis Plastikhimmel nicht fortfliegen kann. Was, wenn ein Vogel käme und ihn auffräße? Nicht auszudenken. Yoshi verdient das beste Leben von allen. Wir stellen sein Häuschen gegenüber meiner Schaukel auf, auf einem verwaisten Beet. Die Holzwände befestigen wir sicher in der Erde. Was braucht ein Frosch? Wasser! Natürlich. Er soll einen ganzen Pool bekommen. Von zu Hause nehme ich eine Plastikdose mit in den Garten. Ich buddele sie soweit ein, dass nur ein winziger Rand aus der Erde ragt. Wir befüllen sie mit Wasser. Neben den Pool stecke ich ein kleines auffaltbares pinkes Schirmchen in die Erde. Yoshi hat jetzt ein Luxus-Leben. Auf das Cocktail-Schirmchen, das ich von irgendeiner Feier mitgenommen habe, bin ich besonders stolz. Dazu noch ein Näpfchen mit Froschsalat. Wir schauen jeden Tag, wie es Yoshi geht. Wenn es regnet, bin ich besonders nervös. Wenn der Wind sein Unwesen treibt, auch. Ist Yoshi noch sicher unter seinem Plastikhimmel? Tag für Tag sitzt er in der Ecke seiner Holzhütte mit dem gleichen stoischen Ausdruck wie am Tag, als er auf der Hand meines Vaters saß.
Eines Tages, vielleicht nach zwei Wochen, lastet der Plastikhimmel unverändert auf den Holzwänden, nichts scheint verrückt worden zu sein. Der Pool lungert verwaist in seiner Erdgrube, das pinke Schirmchen hält tapfer die Stellung. Von Yoshi keine Spur. Hat er sich einen Fluchttunnel gegraben? Doch nichts dergleichen ist zu sehen. Ist das Plexidach einen Moment lang weggeflogen? Ich stelle mir vor, wie Yoshi schutzlos in seinen vier Wänden sitzt. Kurz darauf entdeckt ihn ein Vogel, der ihn entführt und unwiederbringlich seinem kleinen Reich entreißt. Ich finde keine Erklärung. Yoshi ist weg und der Platz, der ihm gehörte, leer. Ich sage mir, dass es vielleicht so kommen musste und er es jetzt besser hat. Wer ist schon gern dauerhaft in einer Luxus-Suite eingesperrt? Eigener Pool mit Schirmchen hin oder her, ein Froschleben ist zwar klein, aber so ganz allein auch kein Hauptgewinn. Ob Yoshi sich manchmal einsam gefühlt hat, obwohl wir ihn jeden Tag besucht haben? Vielleicht hat er den Pool sogar gehasst und das Schirmchen verflucht. Ich frage mich, was Yoshi jetzt wohl macht, zum Beispiel, ob er so klein geblieben ist, wie er an dem Tag war, als er auf der Hand meines Vaters saß. Vielleicht hat er sich verwandelt und ist zu einer stattlichen Kröte geworden. Irgendwo da draußen springt ein brauner Frosch durchs Gebüsch, der zwei Wochen lang mir gehörte und dann wieder der Welt.